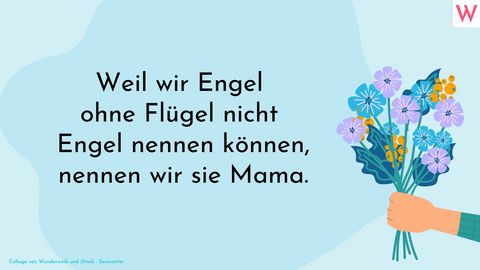Weltschmerz: Warum wir trotzdem die Hoffnung behalten sollten
Viele belasten die politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse, die wir jeden Tag sehen und lesen. Dabei fällt es oft schwer hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Ein Experte erklärt, wie du die Hoffnung behältst und warum das so wichtig ist.
Wenn wir den Fernseher anschalten, Instagram öffnen oder die Zeitung aufschlagen: Nachrichten begegnen uns überall und zu jeder Zeit. Die Klimakrise, Kriege und politische Entwicklungen machen einem oft Angst und lassen einen hinterfragen, ob wir überhaupt noch positiv in die Zukunft blicken sollten. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass es keinen Grund mehr gibt, darauf zu hoffen, dass diese Krisen wenigstens teilweise bewältigt werden können. Vielleicht machst du dir auch Sorgen um deine Zukunft, um die deiner Eltern oder deiner Kinder. Sollten wir also trotzdem weiter die Hoffnung behalten?
Dr. Andreas Krafft ist Leiter des internationale Forschungsnetzwerks des Hoffnungsbarometers, Dozent in St. Gallen und Berlin und beschäftigt sich mit Zukunftsforschung, positiver Psychologie und Hoffnung. Er erklärt, warum wir trotz Krisen und Sorgen, den Glauben an eine bessere Zukunft nicht verlieren sollten und was wir tun können, um neue Hoffnung zu schöpfen.
Wozu brauchen wir Hoffnung?
Hoffnung entsteht in Momenten, in denen wir uns in Krisensituationen befinden. Sie beschreibt, laut Dr. Andreas Krafft, den Wunsch auf Besserung in Verbindung mit dem Glauben daran, dass diese in irgendeiner Form möglich ist. Vertrauen in einen selbst, andere Menschen oder Institutionen spiele ebenfalls eine wichtige Rolle. Denn Vertrauen darin, dass diese Situationen überwunden werden können, helfe dabei sie auszuhalten und auch selbst etwas dafür zu tun, damit das geschieht.
Hoffnung gibt uns also auch in schwierigen Zeiten den Antrieb weiterzumachen und nicht aufzugeben. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir sie uns erhalten. Denn wenn sie schwindet, sei das der optimale Nährboden für Verzweiflung, Gleichgültigkeit und Ängste. Das ist gerade auf persönlicher Ebene ein großer Risikofaktor: „Wir wissen, dass die stärkste Voraussetzung für Depressionen und Suizidalität Hoffnungslosigkeit ist. Wenn man hoffnungslos wird, gibt man auf.“, so Krafft. Bei gesellschaftlichen Themen zeige sich das in der Form, dass man sich beispielsweise nicht mehr für die Demokratie oder auch die Umwelt einsetze. Dies liege vor allem an dem mangelnden Vertrauen in die Regierung und gesellschaftliche Institutionen. In Verbindung mit Angst öffne dies die Türen für autokratische Regime. Deshalb ist es so wichtig, dass wir trotz negativer Entwicklungen positive Bilder für die Zukunft schaffen.
Hilfe bei Depressionen und Co.:Ich kann nicht mehr … was soll ich tun?
Weltschmerz: Wie bleibe ich hoffnungsvoll?
Falls du dich also gefragt hast, ob es sich überhaupt noch lohnt hoffnungsvoll zu sein, ist die Antwort ein großes „Ja“! Auch wenn es manchmal wirklich schwer sein kann, weiter an eine Verbesserung zu glauben, solltest du versuchen dies in dir zu bewahren und auch an dein Umfeld weiterzugeben. Wie du das am besten machst, erklärt der Zukunftsforscher: „Bei Hoffnung geht es um Ungewissheit. Das bedeutet, dass sich etwas verändern muss, von dem wir aber nicht genau wissen, wie es aussehen wird. Die Voraussetzung dafür ist, dass man offen für Neues ist.“ Übermäßiges Denken an die Vergangenheit und der Wunsch, diese wiederherzustellen sei oft eher von Angst getrieben. Deswegen ist es wichtig, nicht zu sehr an altem festzuhalten.
Der Experte gibt einige konkrete Tipps, die dir dabei helfen, deine Hoffnung zu erhalten:
Engagiere dich in deinem Umfeld
Wenn dich eine Sache besonders belastet, ist es hilfreich, wenn du dich fragst: „Was wünsche ich mir, und wie kann ich in irgendeiner Form etwas dazu beitragen?“ Möchtest du dich für Gleichberechtigung einsetzen, könntest du zum Beispiel einem Verein beitreten, der sich damit beschäftigt. Vielleicht kannst du auch an deinem Arbeitsplatz einen Ort dafür schaffen? Suche nach Wegen, die Themen, die dir wichtig sind, zu integrieren und zu fördern. Wie kannst du dein Umfeld so mitgestalten, dass es positiv zur Gesellschaft beiträgt? Schon kleine Aktionen können auf lange Sicht Veränderungen unterstützen und schaffen. Ein weiterer Pluspunkt: Je mehr du dich für andere einsetzt, desto besser geht es auch dir selbst!
Pflege deine sozialen Beziehungen:
Dr. Andreas Krafft erläutert: „Ein Hoffnungskiller ist Einsamkeit. Das bedeutet nicht, dass alleinstehende Menschen grundsätzlich hoffnungslos sind. Aber statistisch gesehen sind Menschen, die ein starkes soziales Umfeld haben, hoffnungsvoller als die, die sich einsam fühlen.“ Deshalb können regelmäßige Treffen mit deiner Familie oder Freund*innen dich auf lange Sicht besser fühlen lassen. Auch der Austausch über deine Sorgen ist ein guter Weg, um dich zu entlasten. Allgemein sei es gesellschaftlich wichtig Zusammenhalt zu fördern und nachbarschaftlich mit seinen Mitmenschen zu sein.
Stärke dein Bewusstsein für die positiven Dinge
Bei all den Nachrichten, die uns tagtäglich begegnen, übersehen wir oft die positiven Dinge, die passieren oder die wir in unserem Leben haben. Das liegt laut Krafft daran, dass wir psychologisch dazu veranlagt sind uns eher mit den negativen Dingen zu beschäftigen. Deswegen kann es sehr hilfreich sein, wenn du dich auf das fokussierst, was eigentlich gut läuft und was dir Kraft gibt. Denke darüber nach, was dir in der Vergangenheit bereits Gutes widerfahren ist und wofür du aktuell dankbar sein kannst. Du hast wundervolle Freund*innen und Familie, freust dich auf ein Konzert oder hast gerade im Job eine tolle Idee gehabt? Dann feiere das! Als Reminder kannst du auch eine kleine Liste mit diesen Dingen machen, um sie festzuhalten. So kannst du dir auch an schlechten Tagen ins Gedächtnis rufen, was dich eigentlich glücklich macht. Es gibt auch viele Plattformen für positive Nachrichten, die zeigen, was in der Welt eigentlich gerade richtig gut läuft. Das geht zum Beispiel bei goodnews.eu!
Erlebe Dinge, die dir guttun
Es ist immer von Vorteil, einen Ausgleich zum Alltag zu haben, besonders in der dunklen Jahreszeit. Aber gerade dann, wenn dich aktuelle gesellschaftliche Ereignisse überwältigen, solltest du darauf achten, dass du schöne Momente für dich schaffst. Schon ein Kino-Besuch, ein leckeres Abendessen oder eine Runde Sport bringen dich auf andere Gedanken. Verbringe auch Zeit mit deinen Liebsten und versuche das Handy dabei wegzulegen. Eine unbeschwerte Zeit füllt deine Kraftreserven wieder auf. Du kannst nur etwas verändern, wenn du auch die nötige Stärke dazu hast!
Schränke deinen Nachrichtenkonsum ein
Krafft rät außerdem den eigenen Nachrichtenkonsum bewusst zu reduzieren. Du kannst dir zum Beispiel eine bestimmte Zeit am Tag nehmen, an der du dich über das aktuelle Geschehen informierst. Auf das endlose Scrollen durch News auf Instagram, TikTok und Co. solltest du dabei im besten Falle verzichten. Denn besonders Nachrichten in Bildform wühlen uns emotional auf, weswegen Lesen oder Hören hier die bessere Option ist. Zudem sind auch Fake News auf sozialen Medien weit verbreitet.

Wie kann ich anderen Hoffnung schenken?
Anderen zu helfen, hat auch einen positiven Effekt auf dich selbst. Aber was genau kannst du tun, wenn du merkst, dass jemand in deinem Umfeld keine Hoffnung mehr spürt? Krafft betont auch hier die wichtige Rolle von Vertrauen. Man könne vermitteln, dass auch, wenn die Person gerade selbst kein Vertrauen in sich hat, man trotzdem an sie glaube. Vor allem Eltern sollten ihre Kinder darin bestärken. Ein weiterer Weg damit umzugehen, sei der Person zu zeigen, dass man für sie da ist, und gleichzeitig Hilfe anzubieten. Frage, wobei du der Person helfen kannst und ihr so vielleicht auch eine Last nehmen kannst.
5 neue Ratschläge, die alle Mütter ihren Kindern unbedingt geben sollten
Beratungsstellen für Betroffene und Angehörige bei psychischer Überlastung:
Wenn du das Gefühl hast, dass du oder eine Person, die du kennst, unter Depressionen oder starken Ängsten leidet, wende dich bitte an folgende Beratungsstellen:
Krisentelefon der “TelefonSeelsorge”: 0800 1110111 oder 0800 1110222
Info-Telefon der deutschen Depressionshilfe: 0800 3344533
Sind bestimmte Gesellschaftsgruppen hoffnungsvoller als andere?
In seiner Forschung beschäftigt Dr. Andreas Krafft sich intensiv mit Zukunft und Hoffnung innerhalb der Gesellschaft. Eine interessante Erkenntnis hieraus ist, dass Frauen in Krisensituationen hoffnungsvoller sind als Männer. Laut dem Experten liege das daran, dass Frauen oftmals mehr gefordert seien als Männer. Daraus würden sie bessere Bewältigungsstrategien für Krisen entwickeln. So würden sie öfter auf Ressourcen wie ihr soziales Umfeld zurückgreifen, um Krisen zu meistern. Zudem seien sie bis zu einem gewissen Maße und in verschiedenen Formen spiritueller als Männer, was ebenfalls ihr Vertrauen und ihre Hoffnung stärke.
Interessant ist auch, dass wir im Laufe unseres Lebens linear immer hoffnungsvoller werden. Gerade junge Menschen hätten noch nicht so viele Krisen bewältigen müssen und seien allgemein im Leben noch nicht so gefestigt. Mit der Zeit lerne man, dass man dazu in der Lage sei, auch kritische Situationen zu überstehen. Erst mit ungefähr 80 nehme die Hoffnung, meist aufgrund von Einsamkeit, wieder ab.
Abschließend rät der Wissenschaftler noch einmal: „Als Gesellschaft müssen wir offen sein für Neues und keine Angst vor Veränderung haben. Neues bedeutet Ungewissheit und hierfür ist Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt ganz wichtig. Und: Wir dürfen weiterhin an das Gute glauben. Der Glaube und das Vertrauen dürfen nicht aufgegeben werden.“

Unser Experte
Dr. Andreas Krafft ist Leiter des internationale Forschungsnetzwerks des Hoffnungsbarometers, Dozent an der Universität St. Gallen, Lissabon und der freien Universität Berlin. Er beschäftigt er sich seit mehr als 20 Jahren mit positiver Psychologie sowie Hoffnungs- und Zukunftsforschung.